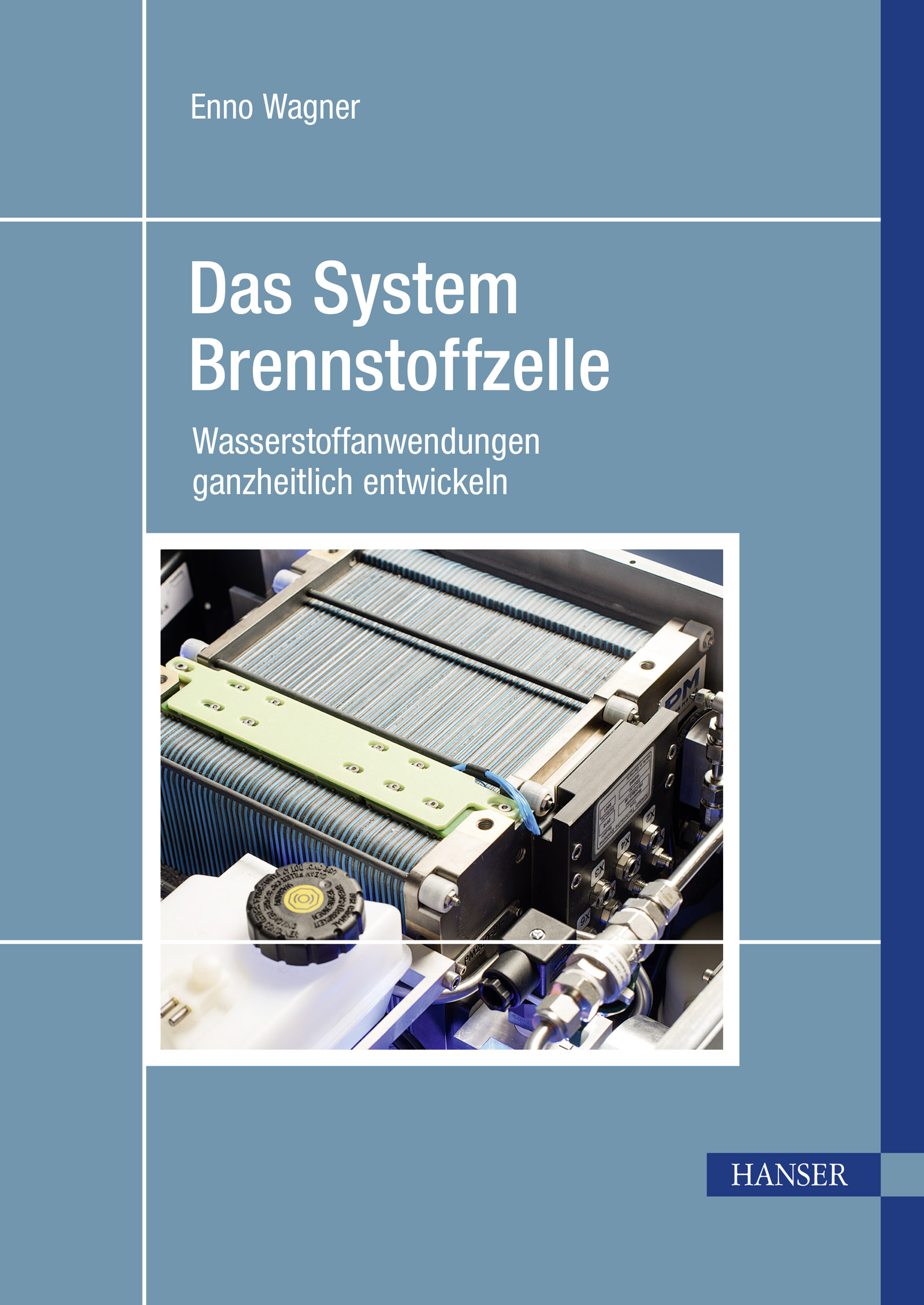- Grundlagen
- Maschinenbau allgemein
- Technische Mechanik
- Technische Thermodynamik
- Technische Optik
- Werkstoffe
- Management
- Konstruktion
- Konstruktion allgemein
- CATIA
- NX
- Pro/Engineer & Creo Parametric
- SolidWorks
- Inventor
- Weitere Systeme
- Sie sind hier:
- Fachbuch
- Elektrotechnik
- Energie- und Umwelttechnik
Das System Brennstoffzelle
Wasserstoffanwendungen ganzheitlich entwickeln
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten
sofort lieferbar
- ISBN: 978-3-446-47260-0
- Buchangaben: 1. Auflage, 09/2023
366 Seiten, Flexibler Einband, Komplett in Farbe
Dieses Buch stellt das System Brennstoffzelle in ganzheitlicher Weise vor. Es widmet sich dem technologischen Zusammenwirken von Wasserstoff (Energieträger) und Brennstoffzelle (Energiewandler) sowie deren Rollen im Gesamtgefüge regenerativen Energiesysteme. Darüber hinaus vermittelt es grundlegende Kenntnisse zur Entwicklung und Konstruktion von Wasserstoffsystemen – von Geräten bis hin zu Großanlagen.
Folgende Themen werden behandelt:
- Hintergründe und Motivation der menschlichen Energienutzung
- Energiebewertung anhand der Begriffe Exergie, Entropie und Syntropie
- Elektrochemische und thermodynamische Grundlagen
- Aufbau und Funktion von Elektrolyse- und Brennstoffzellen
- Systemtechnik und Mechatronik von wasserstoffbetriebenen Geräten und Anlagen
- Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff
- Wasserstoffwirtschaft – politische und ökonomische Weichenstellungen
Das Buch wendet sich an Studierende der Mechatronik sowie der Verfahrens- und Energietechnik, ist jedoch gleichermaßen für Praktiker:innen geeignet, die mit der Entwicklung von Wasserstoffanwendungen betraut sind. Darüber hinaus stellt es eine wertvolle Orientierungshilfe für Entscheider:innen aus dem Energiesektor sowie dem Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau dar.
Dieses Buch stellt das System Brennstoffzelle in ganzheitlicher Weise vor. Es widmet sich dem technologischen Zusammenwirken von Wasserstoff (Energieträger) und Brennstoffzelle (Energiewandler) sowie deren Rollen im Gesamtgefüge regenerativen Energiesysteme. Darüber hinaus vermittelt es grundlegende Kenntnisse zur Entwicklung und Konstruktion von Wasserstoffsystemen – von Geräten bis hin zu Großanlagen.
Folgende Themen werden behandelt:
- Hintergründe und Motivation der menschlichen Energienutzung
- Energiebewertung anhand der Begriffe Exergie, Entropie und Syntropie
- Elektrochemische und thermodynamische Grundlagen
- Aufbau und Funktion von Elektrolyse- und Brennstoffzellen
- Systemtechnik und Mechatronik von wasserstoffbetriebenen Geräten und Anlagen
- Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff
- Wasserstoffwirtschaft – politische und ökonomische Weichenstellungen
Das Buch wendet sich an Studierende der Mechatronik sowie der Verfahrens- und Energietechnik, ist jedoch gleichermaßen für Praktiker:innen geeignet, die mit der Entwicklung von Wasserstoffanwendungen betraut sind. Darüber hinaus stellt es eine wertvolle Orientierungshilfe für Entscheider:innen aus dem Energiesektor sowie dem Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau dar.
Engagierte Fürsprache und Bekenntnis für eine regenerative Wirtschaft mittels erneuerbaren Ressourcen
Das Buch verfolgt neben einer umfangreichen fachlichen Beschreibung der Wasserstofftechnologie nicht minder umfangreich auch wirtschaftspolitische Ziele zur Bewältigung der Energiewende, Stichwort: Dekarbonisierung.
Als Elektroingenieur bin ich v.a. an der technischen Umsetzung, Speicher-Transportprobleme, Wirkungsgrad usw. interessiert, geschichtliche Aspekte beschreibt z.B. Noah Harari umfassender.
Deshalb war mit fortschreitender Lesedauer immer weniger klar, an wen sich das Buch richtet. Da teilweise detailliert auf chemisch/physikalische Reaktionen eingegangen wird und auch die zugehörige Literatur zur Vertiefung aufgeführt wird, könnten Studenten ein potentieller Leserkreis sein. Für diese hat es aber ziemlich viel nicht fachlicher Ballast und auch viele Wiederholungen im Buch.
Als Plädoyer, dass jetzt etwas getan werden muss, und Wasserstoff eine der Lösungen für die Energiewende sein kann, fand ich das Buch berechtigt. Wie immer, kommt es jetzt auf die Umsetzung an.
Was für ein Buch!
Was für ein Buch!
Für mich als gelernten Ingenieur der Elektrotechnik/Regelungstechnik mit Schwerpunkt Systemtheorie und inzwischen langjähriger Berufserfahrung im Bereich des Seeschiffsverkehrs war natürlich die Bezeichnung des Buches „System Brennstoffzelle – Wasserstoffanwendungen ganzheitlich entwickeln“ gleich aus mehreren Gründen anziehend:
Zum Einen verspricht sie, „die Brennstoffzelle“ nicht nur für sich als bloße elektrotechnische Komponente isoliert zu betrachten und also auch ihre möglichen „Wohlfühlumgebungen“ mit ihren jeweiligen Voraussetzungen und Anforderungen in den Blick zu nehmen – eben systemisch zu betrachten. Das ist ja für jegliche praktische Anwendung in welchem Maßstab auch immer unabdingbar.
Zum Anderen hat die Weltschifffahrtsbehörde IMO, eine Fachorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in London, die Dekarbonisierung der weltweiten Seeschifffahrt bis 2050 als Ziel verbindlich beschlossen, und entsprechend bevölkern Beiträge zu konkreten alternativen Antriebslösungen zu Verbrennungsmotoren auf Mineralöl- oder LNG-Basis die Fachgazetten. Hier kommt das „System Brennstoffzelle“ und darin auch die Frage nach auch in der Schifffahrt gut handhabbaren und für die Große Fahrt gut speicherbaren Wasserstoffträgern wie Ammoniak, Methanol u.a. zur Geltung.
Zum Dritten erscheinen ja auch Brennstoffzellen-Anlagen als Netzersatzanlagen als Rückfallebene im Landeinsatz interessant, für institutionelle Träger allemal, aber ebenso – im deutlich kleineren Maßstab – für Privathaushalte.
Diese drei Motivationen haben mich zu dem Buch greifen lassen – und ich wurde nicht enttäuscht; ganz im Gegenteil: Für den Buchautor Wagner ist seine Sicht auf das „System Brennstoffzelle“ bei Weitem nicht beschränkt auf die mir zunächst naheliegende Interpretation der Buchbezeichnung.
Um direkt einem möglicherweise falschen Eindruck dieser Aussage entgegenzuwirken: Wagner erfüllt in zugleich beeindruckender Weite und Genauigkeit den selbst gestellten Anspruch, das „System Brennstoffzelle“ im von mir anfangs so verstanden Sinne darzustellen. Nämlich beginnend bei der grundlegenden Physik der Energie und ihrer Formen und den thermochemischen Grundlagen, geht er weiter zur Darstellung der technischen Gestaltungsprinzipien einer praktisch realisierbaren Brennstoffzelle „an sich“ und wendet sich dann den Fragen der konstruktiven Lösungen in Mechatronik und Systemtechnik zu, die es überhaupt erst gestatten, „die Brennstoffzelle“ in konkreten praktischen Anwendungen einzusetzen. Dabei beginnen die Beschreibungen durchgängig auf fachwissenschaftlichen Niveau (Physik, Chemie, Elektrotechnik, usw.) und arbeiten sich von dort aus unter ingenieurmäßiger Berücksichtigung realer Randbedingungen vor zu konkreten industriellen Lösungen, die auch anhand von prototypischen bzw. serienmäßig verfügbaren Produktbeispielen vorgestellt werden. Dabei betrachtet Wagner konsequent sowohl die Verbrauchersicht von Wasserstoff als Energieträger (Brennstoffzelle zum Zwecke der Gewinnung elektrischer Energie) als auch die Erzeugersicht für Wasserstoff aus elektrischer Energie (Elektrolysezelle). Am Rande: Deutlich wird auch, dass die Brennstoffzellentechnologie nichts für die heimische Werkstatt ist.
Nun könnte man meinen, dass das Buch schließen könnte – denn das „System Brennstoffzelle“ wäre ja in meiner eingangs angenommenen Sicht erschöpfend beschrieben. Aber nun entfaltet Wagner seinen Begriff von „ganzheitlicher Betrachtung“ überhaupt erst so richtig, indem er praktisch alle denkbaren Aspekte von „Wasserstoff“ jenseits der bereits genannten entfaltet: Über den praktischen großtechnischem Umgang mit Wasserstoff an sich, über eine Gesamtdarstellung eines regenerativen Energiesystems beispielhaft für Deutschland, über eine Erörterung von volkswirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Aspekten zu Wasserstoff gelangt er schließlich bei einer „solaren Zukunftsvision“ an, die dann auch – ja sogar astronautische (!) - Aspekte einer „Energiegeschichte der Menschheit“ im Einleitungsbereich des Buches wieder aufgreift. Das scheint zwar in eine Science-Fiction-Zukunft zu verweisen, spannend, weil real vorstellbar aber allzumal.
Wagner liefert also nicht nur ein Lehrbuch über das „System Brennstoffzelle“ mit industrieller Bodenhaftung im engeren Sinne ab, sondern auch eine Art von gesellschaftspolitischem und visionären Diskurs rund um gegenwärtig greifbare und zukünftig denkbare Anwendungen von aus Sonnenenergie direkt oder indirekt gewinnbarem Wasserstoff in einem weiten Sinne von „System Brennstoffzelle“ ab. Das lässt z.B. auch die eher binnenländisch anmutende, kursorisch Betrachtung der in Deutschland ja in Bau befindlichen und geplanten Hochspannungs-Stromleitungen von der Küste in die südlichen Bundesländer (8.2.1 Elektrisches Stromnetz) verzeihen.
In der Summe also: Was für ein Buch!
Lichtblicke, Agitation .. und ein fehlendes Lektorat
Als Leser des Buches, der seinen eigenen M. Eng. –Abschluss, mit Fokussierung auf Fahrzeugentwicklung und Konstruktion, durch die Erstellung einer Fachthesis zu „Energiespeicherintegration in eine Fahrzeugstruktur..“ bei einer FCEV-Projektaufgabe in 2014/15 erlangte …und seit der politisch gepushten Automobilkrise in Deutschland nie einen Karriereeinstieg in seiner Studienvertiefung erhielt .. nachfolgend meine Gedanken und Meinung zu:
Kapitel 1 - die Einleitung
Diese stellt die Lage so dar, als sei die Nutzung von Brennstoffzellen für den Fahrzeugantrieb völlig neu und erst in Planung.
Warum hier noch kein Wort von z.B. dem Toyota Mirai, der durchaus inzwischen sogar schon in zweiter Serie gebaut wird? Darüber hinaus geht der Autor bereits in diesem Bereich des Buches namentlich zwar auf System-Komplikationen bei Sauerstoff und Membranen ein. Es wird jedoch das vom Blickwinkel des Komponenten-Konstrukteurs her, wie ich finde, durchaus nicht unbedeutende Problem der Wasserstoffversprödung an dieser Stelle (noch) übergangen.
Immerhin sollte bei der Entwicklung einer technischen Anlage die grundsätzliche Reaktionsfreudigkeit des Wasserstoffs Beachtung finden. Die Bedeutung der Anwesenheit von molekularem und auch von atomarem Wasserstoff in Kontakt mit Systemkomponenten könnte also schon hier mehr Gewichtung erhalten.
Die Reaktionsfreudigkeit und Diffusion von atomarem Wasserstoff in das Metall-Kristallgitter der metallischen Anlagenteile die sich im Bereich der Zellenmembran befinden, die sehe ich als eine wesentliche Herausforderung bei der mobilen Wasserstoff-Anwendung. Dies ist insbesondere ein Punkt der erhöhte Aufmerksamkeit verlangt bei Systemen die eben keine stationären Industrieanlagen mit permanenter Überwachung durch Systemleitstände und geschultes Betriebspersonal sind.
Einfach so in - Zitat: "Stahltanks" ist Wasserstoff, gerade für eine Anwendung als mobiler Energieträger, nun eben auch nicht lange zu lagern und erst recht nicht mal einfach so über lange Strecken in Leitungen zu transportieren, da eben hier sowohl Druckverlauf im Leitungsnetz, als auch wiederum die chemische Aktivität von Wasserstoff, also Anforderungen an Legierung, die Oberflächenbeschaffenheit und auch die Anzahl zusätzlicher System-Elemente zu beachten ist. Wasserstoff bei solchen Situationen in chemisch gebundener Form transportabel zu machen kann also eine bessere Strategie sein.
Diesen Ausblick, auf eine der gerade zur massenhaften Verbreitung wesentlichen Entwicklungsherausforderungen für die Ingienieure, den hätte man ruhig schon intensiver in der Einleitung bringen können. Gerade weil dort bereits ja ebenso über in der Entwicklung favorisierte Strategien bei alkalischen Verbindungen und über verschiedene Elektrolyte gesprochen wird.
(*erst auf Seite 243ff. fand ich dann in Kapitel 7 z.B. erstmals die Hinweise zu den mir aus meiner Thesis so vertrauten Speichertypen 2 – 4)
Kapitel 2 - Geschichte der Energienutzung der Menschheit:
Die Gemälde-Darstellung zeigt nicht DIE hängenden Gärten der Semiramis in Babylon als historisches Zeitzeugnis - da diese Anlagen zur Lebenszeit des Malers nicht mehr existiert haben. Es sollte also besser als "mögliche subjektive Interpretation basierend auf Überlieferungen" in der Bildunterschrift benannt werden.
Auch gab es im Mittelmeerraum schon deutlich vor den Griechen die Hochkulturen am Nildelta. Darüber hinaus war in Sachen Verwaltung, Informationsmanagement und Kontrolle von Energiesystemen wie fließendem Wasser auch die antike Kultur der Sumerer von Bedeutung für die Zivilisationsentwicklung. Den Startpunkt des geschichtlichen Rückblickes auf lediglich "1600 vor Christus" zu setzen, ist dahingehend wissenschaftlich etwas zu eng gefasst.
Die benannte atmosphärische Änderung von 280 ppm CO2 auf 400 ppm CO2 wird gezielt unpräzise als -Zitat: "Im Zuge der Industrialisierung" Zitat Ende beschrieben, ohne hier konkret eine Jahreszahl für diesen behaupteten Verlauf in konkreten Bezug zu setzen.
Es muss dann die Frage erlaubt sein, ob wir also jetzt im Jahr 2024 diese 400 ppm haben und im Jahre 1840ff diese vermeintlich nicht vorlagen - was eben so nicht mit meinem eigenen Referenzmaterial aus der Mitte des 19. Jhd. in Einklang ist. (Familienbibliothek, Mayers Weltlexikon)
Die Lobpreisung von Marx & Engels und dem Sozialismus, verbunden mit der abwertenden Einordnung in den -Zitat: "westlichen Industrienationen.." Zitat Ende, dies ist eines neutral sachlichen und unpolitischen Ingenieurfachbuch abermals unangemessen. Es übergeht die demokratischen Strukturen mit Mehrheitsbildung in diesen sog. westlichen Nationen, wobei hier dann ohnehin unklar ist, ob "östlich" folglich Japan und Indien, nebst China darstellt - oder ob hierunter, in dem offenkundig politisch verengten Betrachtungsraum des Autors, der Sozialismus in der DDR und die kommunistische Sowjetunion zu verstehen sind.. ? Denn die DDR und auch die Sowjetunion waren, zumindest für jene die diese noch selbst erlebt haben, mitnichten als ökologisch saubere und mit besonderer Reinlichkeit glänzende Epochen der Geschichte bekannt.
- Kernkraft
Die Einlassungen auf Seite 27 nennen als Moderatoren für die Beeinflussung der Energiewandlung bei einem Kernkraftwerk die Steuerstäbe, welche ja direkt in der Reaktorkammer zum Einsatz kommen, als auch das Reaktorwasser, welches ja in den in Mitteleuropa weit verbreiteten Leichtwasserreaktoren für die Interaktion und Einflussnahme auf die Neutronenbewegung nötig ist. Darüber hinaus ist Wasser ja bekanntlich der Mittler bei der Übertragung von Wärmeenergie. Letztlich kommt Wasser auch bei der Wandlung in mechanische Energie zum Einsatz, um uns dann elektrische Energie zu liefern. Hierzu im Konflikt tritt die auf Seite 29 getroffene Aussage –Zitat: „die Leistung von Kernkraftwerken praktisch nicht regelbar ist“ Zitat Ende.
Eine solche Behauptung sollte durchaus Diskussion auslösen. Denn die häufig in diesem Themenfeld benutzte Begrifflichkeit „Grundlastfähigkeit“ bedeutet ja nicht ausschließlich einen 24/7 existierenden nationalen Strombedarf in kWh decken zu können. Vielmehr geht es ja darum, dies wetterunabhängig in jeder Jahreszeit Tagsüber, wie auch bei Nacht, Energiewandlung zu ermöglichen.
Unter diesem Aspekt möchte ich nun vom Blickwinkel des Ingenieurwesens behaupten es besteht sehr wohl die Möglichkeit die für den Netzkunden verfügbare Menge an Elektrizität auch bei Kohle-, Gas- und Atomkraftwerken zu beeinflussen. Da ja durchaus Wege zum Eingriff bei der Netzauslastung bestehen. Von modularer Verknüpfung mehrerer Reaktorblöcke eines Kraftwerkes, Stickwort Skalierbarkeit und SMR (siehe die Pläne von Amazon oder Google) und über Steuerstäbe zum Eingriff an Abschirmung und kritischer Masse, bis letztlich zur bewussten Beeinflussung des Turbinenwirkungsgrad an Hand des Temperaturgradienten auf der Dampf-Turbine existieren durchaus Wege zur Einflussname.
Die getroffene Aussage mit einer Verstopfung des Stromnetzes durch Kernkraft ist also sehr „politlastig“ und klingt eher nach Parteiagenda.
Genauso könnte man dann ja postulieren, es bedarf überhaupt keiner Windenergie und keiner Photovoltaik, da ja deren Ausbeute bereits durch die Kernkraft gedeckt war..?
In diesem Themenkomplex ist es dann besonders kurios, auf nachfolgender Webseite des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) die Aussage zu finden –Zitat: „..auch für die zwei Siedewasserreaktoren, die sich derzeit in Deutschland noch im Leistungsbetrieb befinden..“ Zitat Ende.
gesehen 19.11.2024, 23:32 , https://www.nuklearesicherheit.de/wissen/funktionsweise-von-kernreaktoren/
Die Aussage „derzeit noch im Leistungsbetrieb befinden“ impliziert schließlich es gäbe doch noch aus deutschen Reaktoren stammende Elektrizität. Was sowohl der in den öffentlichen Rundfunkanstalten gegenüber dem Bürger kolportierten Darstellung entgegen steht, als auch dem Schluss-Absatz zu Kapitelbereich 2.2.3 oben auf Seite 29 widersprechen würde.
Auf Seite 30 wird behauptet Biomasse würde grundsätzlich immer der Nahrungsmittelproduktion und der Holzwirtschaft entgegen stehen. Mit dieser Behauptung zeigt der Autor eindeutig ein sehr einseitiges Denken.. .
Denn der direkte Wortsinn von „Bio“ ist ja wohl die Organische (lebende)Welt und “Masse“ steht in Bezug zu Materie, möchte ich da entgegnen. Wodurch man also an organische Materie denken sollte, unabhängig davon, ob diese Materie noch einen von sich aus lebenden Zellverband, also eine herumwandernde Kuh darstellt, oder eben z.B. ein Knäuel aus Schafwolle ist. Beides stellt Biomasse dar, es ist organische Materie.
Somit muss die vom Autor propagierte Behauptung zur Diskussion gestellt werden.
Denn ist in der Menschheitsgeschichte nicht vielmehr z.B. wegen der Nahrungsmittelproduktion überhaupt erst die Möglichkeit entstanden, besser sogar eine Notwendigkeit, eben die enorme Menge an unbeachteter Biomasse zu nutzen? Jene Biomasse die eben nicht das Schnitzel auf dem Teller ist. Wir würden z.B. in Knochen und Fell ersticken, wenn diese Biomasse aus dem Prozessverlauf des Schlachthofes einfach vor dem Betrieb auf dem Gehweg gestapelt wäre.
Ebenso verhält es sich mit der Holzindustrie. Nicht der ganze Baum wird zur Schrankwand. Es fällt auch Rinde an, Nadeln und Geäst. Diese Biomasse besitzt ihre Existenzberechtigung und es spricht für Vernunft und ist also konsequent auch sie für die menschliche Gesellschaft zu nutzen.
Eine Forschung zu neuen umfassenderen Verwertungsprozessen und zur Verbesserung bei bestehenden Verfahren, um deren Wirkungsgrad zu steigern, ist also geradezu nötig. Denn dabei können auch die Verwertungsquoten der ohnehin schon in der Bewirtschaftung vorhandenen Biomasse gesteigert werden.
Bei der Aussage auf Seite 31 –Zitat: „Hier sind elektrochemische Batteriesysteme (aktuell bevorzugt: Lithium-Ionen-Batterien, aber auch Blei-Säure-Akkumulatoren) die erste Wahl. Sie speichern den elektrischen Strom bei sehr hohen Wirkungsgraden und arbeiten mit kleinen sowie mit teils sehr großen elektrischen Strömen, ohne Schaden zu nehmen.“ Zitat Ende.
Nun, da möchte ich vom Blick des Entwicklungsingenieurs her Einspruch erheben. Konkret gesagt ist ja gerade der Lade- und Endladeprozess mit einer strukturellen Belastung verbunden. Denn das verbindende Prinzip der genannten Batterien ist ja der Elektronenfluß außerhalb der Batterie, welcher unabdingbar an den Ionentransport in den Zellsystemen gekoppelt ist.
Jene Ionen sind ja physisch umgelagerte, also bewegte Materie und diese tritt in Interaktion mit den mikroskopischen Strukturen der Anoden und Kathoden im Inneren der Zellen. Man denke z.B. an den nötigen konstruktiven Aufwand in den Lithiumsystemen, um Interkalation, also die unkontrollierte Anhäufung von Ionen bei der Einbindung in die Elektroden, zu minimieren. Ein von zu hoher Systemtemperatur und großer Lastanforderung erzeugtes „Gedränge“ im Einlagerungsablauf der Ionen bewirkt Stück für Stück strukturellen Verschleiß der Komponenten und Beschichtungen. Nicht ohne Grund sind ja Parameter wie der Temperaturverlauf und auch Anzahl und Umfang von Lade- und Endladezyklen ein Bewertungskriterium bei der Zustandskontrolle von Lithium basierten Energiespeichern in den heutigen Elektrofahrzeugen.
Insbesondere die so gern von fachlich inkompetenten Politikern kolportierte Zielsetzung die Elektrofahrzeuge am nationalen Stromnetz als Zwischenspeicher zu nutzen sollte also kritisch beäugt werden. Denn wer übernimmt hierbei die finanzielle Kompensation? Die nicht dem Fahrbetrieb dienenden Lade- / Entladezyklen verursachen letztlich eine frühzeitige Alterung des Energiespeichers in den dann eingebundenen Fahrzeugen der Bürger.
Kapitel 3.4
- Bedeutung für die Energiewirtschaft
Auf Seite 67 wird die Aussage getroffen, die Menschheit erzeuge mittels Windkraftanlagen und Solarparks Energie. Diese Formulierung ist nach meiner Erinnerung an die Lehrsätze der Schulzeit so nicht richtig. Es müsste ja vielmehr lauten: „..sondern diese mittels Wind- und Solarparks wandeln müssen“
Kapitel 4
- Thermochemische Grundlagen
In diesem Kapitel wird das Sachbuch dann wie erwartet zu einer Abhandlung im Stile eines Skriptums für Physik- oder Chemiestudium.
Dies wirkt, wie es der Autor auch im weiteren Textverlauf treffend anspricht, für den nicht direkt an den physikalisch-mathematischen Hintergründen interessierten Techniker, oder Mechaniker aus der Fahrzeugtechnik stellenweise etwas trocken. Doch es ist eben wichtig diese Grundlagen für den Einblick in die Hintergründe der Forschungsarbeit zu besprechen.
Kapitel 5
- Elektrolyse- und Brennstoffzellen
Mit diesem Kapitel konnte ich den für mich persönlich interessanten Bereich der Gesamtthematik identifizieren. Denn die Vielfallt der Brennstoffzellensysteme und ihre jeweils eigenen systemtechnischen Gegebenheiten, dies wurde nicht derart intensiv in meiner Studienzeit an einer Maschinenbaufakultät behandelt. Doch gerade für den Schwerpunktbereich Entwicklungsingenieur-Fahrzeugtechnik, oder auch für den Anlagenbauer ist der Vergleich von Eigenheiten und die damit verbundenen entsprechenden Einsatzfälle wichtig.
Bei der Systembeschreibung zur FestoxidBrennstoffzelle mache ich mir allerdings Sorgen. Wie stabil läuft diese – oder anders gesagt, was passiert bei einer „Drift“ des Betriebspunktes? Ist es hier in einer Fehlersituation möglich, an Anlagenteilen die mit Luft in Kontakt kommen auch Hotspots von 1200 °C zu finden?
Denn wenn man Stuttgart abriegelt, unter der Behauptung man wolle schädliches Stickoxid verhindern, so muss ja eine solche Emission folglich auch bei einer Brennstoffzelle gesellschaftlich negativ belegt sein.. ?
Auf Seite 127 findet sich in der Bildunterschrift 5.6 eine falsche Zuordnung –es steht dort das Wort „links“, wo es gemäß Bildanordnung in der Ausgabe als eBook (.pdf) ja eigentlich „rechts“ sein muss.
Auf der Seite 130 ist dann der Satz zu lesen –Zitat: „Auf diese Weise kann sowohl die Zelle wirkungsvoll temperiert als auch die Reaktionswasser zu- bzw. abgeführt werden.“ Zitat Ende.
Es soll hier bestimmt „das Reaktionswasser“ stehen.
Eine weitere sprachliche Abweichung finde ich bei Seite 141.
–Zitat: „Bei höheren Differenzdrücken kommt es zum Durchschlagen, und der Wasserstoff blubbert auf der gegenüberliegenden Seite heraus (Bubble Point).“ Zitat Ende.
Auch wenn natürlich das englische Wort Bubble mit Blase zu übersetzen ist, so denke ich „..der Wasserstoff tritt auf der gegenüberliegenden Seite heraus..“ wäre eher einer akademischen Schrift angemessen.
Grundsätzlich fällt mir immer wieder der Gebrauch des Wortes „Protonen“ in dieser Fachschrift auf.
Nach meiner Erinnerung aus dem Chemie-Unterricht an der Gesamtschule sind Protonen subatomare Teile, aus dem Nukleus. Ein positiv geladenes Atom, also ein nach außen elektrisch positives Ion, dies wäre mit dem Terminus „Kation“ zu belegen. So wie ein elektrisch negatives Atom ebenso ein Ion ist, nur eben ein negatives und mit dem Fachbegriff „Anion“ beschrieben wird.
Wenn an den beschriebenen Membranen tatsächlich Protonen auftreten, so würde folglich eine Kernspaltung vorliegen.. . Ich denke es wird deutlich worauf ich hinaus will?
Der Ausdruck „Proton Exchange Membrane“ ist also nach meiner, wenn auch bisher leider wissenschaftlich unbedeutenden, Meinung als Leser dieses Werkes falsch. Es ist eine offenbar aus Unkenntnis in den englischen Sprachgebrauch eingebrachte Interpretation der Wortbedeutung zu PEM.
Für „Polymere Elektrolyte Membrane“ spricht hingegen der Umstand, als Membran auf einem aus Polymerstruktur der Moleküle basierenden Werkstoff zu bestehen. Darüber hinaus übernimmt eine solche Membran ja die vermittelnde Aufgabe den inneren Ladungstransport zu ermöglichen. Die Ionen bewegen sich also hier wie in einem Elektrolyt.
Die Seite 150 enthält im zweiten Textabsatz wie folgt – Zitat: „wobei der wasserabstoßende Charakter durch die runde Tropenform erkenntlich wird.“ Zitat Ende.
Es ist doch bestimmt die Tropfenform gemeint, oder?
Bei Seite 187 lautet ein Satz –Zitat: „Litzen werden in der Regel mit PCV-Umhüllungen isoliert, bei hoher Wärmebeanspruchung kommen auch Silikonkabel zum Einsatz.“ Zitat-Ende.
Meine Vermutung ist der Verfasser meint Polyvinylchlorid (PVC –Isolierungskennung Y), wobei dieses inzwischen wegen des Umweltaspekts auch kritisch betrachtet wird. Nach DIN 76722 sind allerdings auch Polyurethan (PUR –Isolierungskennung 11Y) und Polyethylen (PE –Isolierungskennung 2Y) im technischen Einsatz.
Die Benennung von Q1 ..Q4 auf Seite 190/191 als „Ventile“ finde ich kreativ, da sie doch auf Seite 185 in der Tabellendarstellung aus Bild 6.15 fachgerecht als das elektrische Bauteil Diode identifiziert wurden. Man bekommt dabei den Eindruck der Verfasser ist eher im Fluid-Anlagenbau beheimatet und interpretiert darum funktional ähnliche Dinge mit einem ihm geläufigen Terminus.
Im ersten Absatz der Seite 198, direkt unter dem Beispiel, da finde ich –Zitat: „.. besteht im Einsatz eines MessShunts. Die ist ein Widerstand mit einem relativ kleinen Wert,..“ Zitat-Ende.
Es sollte hier sicher doch stehen: „Dies ist ein ..“ ?!
Seite 208 spricht von –Zitat: „..mit einem entsprechenden Gebläse durch den Brennstoffzellensack gefördert.“ Zitat-Ende. Es soll vermutlich der Brennstoffzellenstack sein.
Der Satz auf Seite 219 -Zitat: „Im einfachsten Fall ist die ein 5-V-Signal, das ein- oder ausschaltet.“ Zitat-Ende braucht ebenfalls eine Korrektur. Hier soll bestimmt „.. ist dies..“ stehen.
Ein weiterer fehlerbehafteter Satz befindet sich auf Seite 220. Bei der Beschreibung in –Zitat: „Im einfachsten Fall eines seriellen Busses werden einzelnen Bits nacheinander übertragen.“ Zitat-Ende, kann es letztlich nur „..werden einzelne Bits..“ lauten. Als Alternative bietet sich noch an „werden die einzelnen Bits..“.
Seite 228 – Zitat:
„Aufgabe zu, da hiermit das Reaktionswasser ausgetragen und damit auch die Fechte der Membra-nen im Inneren des Stacks maßgeblich beeinflusst wird.“ Zitat-Ende.
Vermutlich ist hier „..die Feuchte..“ gemeint.
Seite 231, Bild 6.44 –hierzu hätte ich eine Verständnisfrage meinerseits:
Sehe ich das richtig, bei der vorgelegten Darstellung besteht das Risiko, einen defekten Zellenstack nicht gezielt im laufenden Betrieb vom System und der Gasversorgung entkoppeln zu können? Es hängen ja alle Stacks ohne jegliche individuelle Zu- und Abflusskontrolle direkt an der Hauptleitung.
Seite 245, erster Absatz, Zitat:
„In die Behälter sind zudem Wärmeübertrager mit einer großen Oberfläche eingebaut ..“ Zitat-Ende. Von Wärmeüberträgern zu schreiben wäre wohl das bessere Deutsch. Dieser Hinweis bezieht sich exemplarisch auch auf den letzten Satz der Seite 248.
Seite 252, Zitat:
„Die Verdichter selbst können nicht eins zu eins übernommen werden, die die Verdichtung von Wasserstoff aufgrund der geringen Gasdichte und der hohen Wärmeleitfähigkeit vollkommen anders als die von Erdgas verläuft.“ Zitat Ende. Es sollte hier „..da die Verdichtung..“ lauten.
Seite 254, Bild 7.13
Die zusätzliche Aussage unter dem Bild, bezüglich einer bewussten Spiegelung (durch den Autor?), ist überflüssig, oder zumindest verwirrend. Schließlich wird ja gemäß Position von Brücke, Rettungsboot und Bugspitze, sowie auch am Schriftzug klar erkennbar - es ist die rechte Rumpfseite zu sehen.
Ich möchte also behaupten, die Person die auf Wikipedia die Bilddatei hochgeladen hatte, die irrte sich einfach beim Dateinamen.
Seite 258, Kapitel 7.5 Wasserstofffahrzeuge
Zitat: „Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Modelle iX35 Fuel Cell sowie NEXO der koranischen Firma Hyundai und um den Mirai des japanischen Herstellers Honda. Diese erste Brennstoffzellen-Pkw sind mit einer eigenen Plattform durchentwickelt worden und werden seit einigen Jahren in kleinen oder mittleren Serien gebaut.“ Zitat-Ende.
Der Autor kommt eindeutig nicht aus dem Bereich Fahrzeugentwicklung/FCEV. Denn der TOYOTA Mirai kommt nicht von Honda, da Honda als FCEV die aktuelle Version des CR-V im Angebot hat. Hyundai ist kein Fahrzeughersteller aus der islamischen Welt, hat keinen Bezug zum Koran.. sondern stammt aus Korea – ist also „koreanisch“.
Darüber hinaus sollte grammatikalisch richtig in der Überarbeitung dieses Fachbuches der zweite Satz besser mit „Diese ersten Brennstoffzellen-PKW..“ beginnen.
Seite 264 –Zitat: „..können hieraus auch Karbonfasern hergestellt werden, die wiederum
für die Anfertigung Wasserstofftanks benötigt werden.“ Zitat-Ende. Da fehlt ein „von“.
Zitat:
„Eine umweltfreundliche Herstellung von stickstoffhaltigen Düngemitteln kann
gut auf Basis von Ammoniak (NH3) stattfinden, das in sonnenreichen Gegenden
aus Wasserstoff und Stickstoff hergestellt wurde“ Zitat-Ende.
Sollte es hier nach den Regeln der deutschen Grammatik nicht eher lauten „der in sonnenreichen Gegenden..“? Denn „der Ammoniak“ ist ja gemeint.
Seite 273/274, 8.3 Windkraft
Zitat: „Die meist drei Rotorblätter werden an der Narbe zusammengeführt, wo die Drehbewegung in einer gelagerten Welle abgenommen werden kann.“ Zitat-Ende.
..sowie Bild 8.4
Die Rotoren sind nicht verletzt und von alten Wunden gezeichnet.. .
Die zentrale Einheit eines symmetrischen rotierenden Systems wird Nabe genannt.
Seite 275 – Zitat:
„Hierbei wird eine Vielzahl von großen Windrädern im flachen Meer vor der Küste aufgeschlagen, wobei die Fundamente ..“ Zitat-Ende. Es kommt beim Leser der überarbeiteten Auflage sicher besser an, hier „aufgestellt“ oder „errichtet“ zu verwenden.
Seite 279, 8.2.5 Wärmekraftanlagen
Zitat: „Dennoch wird der größte Teil der ursprünglichen Energie in Form von Abwärme und Schadstoffen an die Umgebung angeführt.“ Zitat-Ende.
Die Energie wird an die Umgebung „abgeführt“.
Seite 283, 8.2.6 Brennstoffzellen-Kraftwerke
Zitat: „In Zeiten mit geringem Angebot an Sonnen- oder Windenergie werden künftig zunehmend Brennstoffzellen-Kraftwerke anstelle von Wärmekraftprozessen eingesetzt werden, weil diese..“
Zitat-Ende.
Bitte das zweite „werden“ streichen, denn grammatikalisch erfüllt einmal „werden“ die Aussage.
Seite 295, 8.3 Chemische Energie
Zitat: „Hierzu wird Wasserstoff, der vor allem im Sommern und im Herbst
mit überschüssigem Solar- und Windstrom produziert wurde, in..„ Zitat-Ende.
Besser den Satz berichtigen zu „im Sommer..“.
Seite 319, Zitat:
„Was passiert nun aber, wenn die Durchschnittstemperatur um 5, 6 oder gar 7 Grad
ansteigt? Tatsächlich wissen wir es nicht genau.“ Zitat-Ende.
Bei solch einer Aussage verweise ich gern auf die Frage „War es jemals in der Erdgeschichte um besagte 5, 6 oder eben 7 Grad wärmer als im jetzigen Jahresmittel?“
–und folglich:
Wie war das Habitat mit Namen Erde in diesen Perioden der Geschichte des Planeten?
Seite 321, Zitat:
„Da sauberes Wasser die Grundlage allen Lebens und vor allem der Landwirtschaft ist, geht mit einer Wasserkrise auch in absehbarer Zeit eine Ernährungskrise einher.“ Zitat-Ende.
Nun, also mir ist der Einsatz von gezielt aufbereitetem Trinkwasser in der Landwirtschaft neu. Wird da denn wirklich das saubere Trinkwasser verwendet, oder nicht doch eher der direkte Niederschlag des Regens und normale Brunnenspeicher zur Berieselung von Äckern genutzt?
Seite 321, Zitat:
„Tabelle 9.2 Virtueller Wasserverbrauch und Treibhausgasemissionen verschiedener Lebensmittel und Konsumgüter (Lesch 2018) sowie Energieverbrauch in der Landwirtschaft (Clausing 2014)“ Zitat-Ende.
Die gezeigte Tabelle ist nicht nach seriös wissenschaftlichen Grundsätzen gestaltet.
Wenn Dinge gegeneinander in Bezug auf einen bestimmten Parameter hin verglichen werden sollen (z.B. Wasserverbrauch in Liter, oder die mit dem Produkt verknüpften Gasemissionen)
– so muss auch die Menge für jedes zu betrachtende Objekt auf eine einheitliche Eingangsgröße normiert werden.
Es sollte klar sein, „eine Mandel“ zu „ein Liter Bier“ erfüllt diese Bedingung nicht.
Es muss hier also entweder auf einheitliche Produktmassen skaliert werden, oder z.B. als Alternative auch der Nutzwert als Einheitsgröße betrachtet werden, sprich „ Für X Joule an Nährwert aus Mandeln bedeutet es Aufwendung von so und so viel Wasser.. wohingegen die X Joule an Nährwert aus Bier einen Aufwand von so und so viel Wasser bedeuten“.
Darüber hinaus ist auch die von Verfechtern der pflanzlichen Nahrung propagierte sog. Mandel-“Milch“ letztlich ein Ergebnis technisierter Monokulturen mit Wasserbedarf und chemischer Behandlung.
..und nein, ich bin kein Freund von Bier
Es fällt also eine gewollte Verzerrung mit politischem Hintergrund in der Tabellenzusammenstellung auf. Dementsprechend möchte ich dann also hier bewusst provozierend die Behauptung aufstellen: „Wir brauchen weniger Moslems im Land - denn Schweinefleisch ist besser für den Planeten ..?!“
Sie sehen also was man mit solchen Tabellen anstellen kann.
Seite 322, Zitat:
„So wird unter anderem in Chile, das mit 8 Millionen
Tonnen über die größten Lithiumreserven verfügt, in der Atacama-Wüste täglich bis zu 21 Millionen Liter Wasser aus einer lithiumhaltigen Sole verdunstet (ZDFDokumentation). In einer Recherche des Energiekonzerns E.ON hingegen wird davon ausgegangen, dass täglich nur 130 Tonnen lithiumhaltige Sole gefördert werden, aus denen am Ende 23 Tonnen reines Lithium gewonnen werden, sodass man
von einem spezifischen Wasserverbrauch von lediglich 900 Liter je kg Lithium ausgehen kann (E.ON Energie Deutschland GmbH 2021).“ Zitat-Ende.
Auch hier gilt wieder meine Anmerkung bezüglich fehlender Objektivität.
Wenn die Aussagen von zwei unterschiedlichen Quellen zu einem einzigen Sachverhalt (der Lithiumförderung in besagter Hochlandwüste in Chile) gegenüber gestellt werden, dann muss dies auf Basis vereinheitlichter Eingangsparameter geschehen.
Die einen sprechen von „Wasser“, die anderen von einem Endprodukt mit Namen Salz.
Es sollte also von jedem der Akteure (EON / ZDF) zunächst explizit abgefragt werden:
„Wie viel WASSER verdunstet an Ort xyz nach eurer Zählung?“
.. und dazu folgend „Wie viel Salz Feststoff wird an dem Ort xyz erzeugt?“
Erst dann sind beide Aussagen gegenüber zu stellen, und es wird möglich über die jeweilige Zielset-zung etwaiger Abweichungen zu diskutieren.
Seite 325, Zitat:
„Für die Umsetzung wurden von der Bunderegierung bereits rund 2 Milliarden Euro Fördermittel zum Beispiel über das Nationale Innovationsprogramm..“ Zitat-Ende.
Hier ist doch sicher die „Bundesregierung“ gemeint.
Seite 337, Zitat:
„Doch wie sich die Menschen die solaren Energieströme in Zukunft gezielt zunutze machen können, um ihr Wissen und ihre Intelligenz zu steigen, davon haben wir heute nur eine vage Vorstellung.“
Zitat-Ende.
Es geht hier um Steigerung der Intelligenz, das Wort lautet demnach „steigern“.
Mein Fazit
Zunächst möchte ich bemängeln:
In diesem Buch scheint nach meinem Eindruck, gerade auch in den hinteren Kapiteln, eine LinksRotGrüne politische Agenda durch. Dinge wie die CO2-Bepreisung sind in der jetzigen Form mitnichten ein unvermeidbares Naturgesetz, sondern eben ein von Lobbygruppen installiertes System, mit dem diese dann Geld machen. Die Evolution des Menschen war darüber hinaus immer auch von Sozialdarvinismus berührt. Ein Überleben aller Nationen und Kulturen des Planeten ist also durchaus keine Grundvoraussetzung für den Fortbestand der Menschheit.
Auch die Behauptungen einer politisch finanzierten Struktur wie dem IPCC sind weder „heilige Kuh“ noch unwidersprochen. Eine installierte politische Kontrolle der Meinungsöffentlichkeit stellt viel-mehr sicher, den Kritikern (selbst jenen aus eigenem Hause) nicht eine breite öffentliche Beachtung zukommen zu lassen.
Von diesen politischen Betrachtungen einmal abgesehen, sehe ich den Umstand so viele Schreibfehler zu finden schon als erschreckend. Gibt es im Verlag kein Lektorat mehr?
Ich selber habe, auch als Akademiker, große Schwierigkeiten mit Rechtschreibung und Zeichenset-zung. Der Unterschied ist halt – ich betreibe keine Erwerbstätigkeit mit meiner Betätigung des Schreibens. Wenn also selbst mir diese Punkte auffallen, nicht nur hier, sondern auch sonst in der täglichen Presse- und Medienlandschaft, dann zeichnet dies ein trauriges Bild über den Stand der Qualität von Medien.
Als positiv ist anzumerken, wenn ich auch beim Lesen des Werkes mit meinen Gedankengängen der Kapitelgliederung häufig voraus war: Die in diesem Werk gezeigte Vielschichtigkeit der Informationen und Detailbetrachtungen zum Thema Brennstoffzelle und Wasserstoff ist löblich!
Viel Freude hatte ich hier insbesondere bei der Thematik „Energie und Information“.
Guter Einstieg in das Thema Brennstoffzelle, der weiter reicht
Ich habe das Buch während einer Studie zur Arbeitsmedizin gelesen, in der mir viele Zeitblöcke zur Verfügung standen, in denen ich konzentriert an eigenem Material arbeiten sollte. Die volle Konzentration auf den Inhalt des Buches war somit gegeben.
Die Einleitung bietet eine gute Einführung, die auch für den Laien verständlich dargestellt ist. Kritikpunkte bzgl. der Technologie Brennstoffzelle werden ernsthaft aufgegriffen und gut beantwortet. Es bleibt nur ein wenig fraglich, ob nicht die Brennstoffzellentechnologie einen Wettlauf gegen sich weiterhin verbessernde Batterietechnologie liefert, die sie nicht mehr gewinnen kann (z.B. bei der Stromversorgung elektrischer Lkw und auch bei stationären Anwendungen). Allerdings kann ich auch nicht sagen, inwiefern die "Batterie-Branche" hier ein Bild des Potentials von Batterien durch die "rosarote Brille" zeichnet.
Den Vergleich von biologischer Evolution (z.B. das Entstehen neuer Arten) mit technischer Innovation (neue Technologien & Produkte), auf Basis der eingeflossenen (bis dahin vorhandenen) Energie, fand ich ehrlich gesagt, weit hergeholt. Meiner bescheidenen Meinung nach kann dies nur sehr begrenzt Einblick liefern, da hier sehr deutlich von Grund auf unterschiedliche Konzepte/Entitäten über eine Kenngröße/Skala verglichen werden sollen, deren prinzipielle Unterschied damit gänzlich nivelliert werden. Ich habe den Eindruck, dass das dahinterstehende, im Buch tiefgehend beleuchtete Konzept direkt aus der eigenen Forschungsarbeit des Autors stammt (vgl. auch Verweis auf seine eigene Veröffentlichung) und deshalb, als sein persönliches Anliegen, diesen Raum erhält.
Äußerst positiv hervorheben möchte ich die Abschnitte des Buchs, in denen der Autor die Funktionsweise einer Brennstoffzelle nicht nur sehr gut schematisch-qualitativ erläutert, sondern dies auch in mathematische Beschreibung überführt, die physikalisch fundiert ist (aus statistischer Physik, Elektrodynamik, etc.).
In diesem Sinne:
Vielen Dank für ein sehr interessantes Buch, dass ich mir auch weiterhin "zu Gemüte führen" werde.
Das System Brennstoffzelle aus vielen Blickwinkeln. Technische Betrachtung, Anwendungsgebiete und Nutzen
Das Buch „Das System Brennstoffzelle“ beschreibt die Thematik aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln. Über die Grundlagen der Energienutzung und -Umwandlung wird der technische Aufbau verschiedener Brennstoffzellentypen beschrieben. Dabei wird ausführlich auf Vor- und Nachteile eingegangen. Da das gesamte System betrachtet wird, beschreibt der Autor auch externe Funktionseinheiten, die nicht speziell zu einer Brennstoffzelle gehören. Über den technologischen Aspekt hinaus, beinhaltet das Buch auch eine Darlegung der Möglichkeiten, wie Brennstoffzellen und die Elektrolyse einen Beitrag zu einer Energieversorgung und zur (Klima-) Zukunft leisten können.
Der Autor hat einen sehr ambitionierten Ansatz gewählt, Brennstoffzellen als Gesamtsystem, technisch und gesellschaftlich, zu beschreiben. Mein Antrieb als Laie war, die Brennstoffzelle technisch besser zu verstehen. Dies konnte das Buch mir gut vermitteln. Allerdings muss ich die gesellschaftliche Einordnung des Autors ausdrücklich hervorheben. In der öffentlichen Diskussion werden Kosten und Nachteile genannt, um Ängste und Ablehnung bei Thema Wandel zu erzeugen. Der Autor nimmt den Faden auf und zeigt zusätzlich, neben der absoluten Notwendigkeit des Handelns, die Chancen in vielen Bereichen auf.
Dieses Buch hinterleuchtet das System der Brennstoffzelle, sowie dessen Anwendung
Normalerweise mag ich es nicht, wenn Politik und eigene Meinung des Autors in einem Fachbuch repräsentiert werden. In diesem Buch allerdings betont es die Notwendigkeit dieser Technologie.
Den Teil über Ventil und Flanschtechnik hätte man ausführlicher gestalten können, für einen allgemeinen Eindruck reicht das vollkommen aus!
Vielen Dank für dieses Buch und den Umfangreichen Einblick in diese Thematik. Das ist dem Autor tatsächlich gut gelungen.
Plädoyer für eine nachhaltige Energieversorgung
In seinem Buch "Das System Brennstoffzelle" analysiert der Autor, Enno Wagner, den aktuellen Stand und die Zukunft der Brennstoffzellentechnologie im Kontext der Energiewende.
Der Autor betont die Dringlichkeit, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, um katastrophale Klimafolgen zu vermeiden. Er fordert eine schnelle Reduktion der CO2-Emissionen und kritisiert den Bau neuer Gas- und Kohlekraftwerke.
Als ganzheitlichen Lösungsansatz schlägt Wagner vor, nicht nur nach alternativen CO2 Einsparpotentialen für die Haupt-Emittenten zu suchen, sondern diese generell zu hinterfragen: Regionale Produktion sowie nachhaltige Landwirtschaft könnten die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern und eine nachhaltige Gesellschaft schaffen. Mittels Elektrosyse Strom-Überschüssen hergestellter grüner Wasserstoff ist dabei das Mittel der Wahl, um die erzeugte Energie zu speichern und bei Bedarf durch Brennstoffzellen zu verstromen.
Etwas überzogen kommt mir ein Gedankenexperiment des dritten Kapitels vor, nach dem sich die menschengemachte Zerstörung der Erde aus Naturgesetzen herleiten lasse bzw. dadurch angetrieben würde.
Insgesamt hat mir das Buch gut gefallen. Es ist informativ und liest sich weitgehend locker.
Beeindruckend umfassend
Der Titel ist eine Untertreibung, das Buch hat sehr viel mehr zu bieten, als aktuelle Information zu Brennstoffzellen. Mir gefällt sehr, wie der Autor Grundlagen und aktuellen Wissensstand aus allen beteiligten Wissensgebieten liefert, nicht nur technisch, neben dem Hauptthema Brennstoffzelle auf unterschiedliche Energiespeicher eingeht und alle Formen der Energiegewinnung, Energiespeicherung und Energietransport / -verteilung in einen aktuellen wirtschaftlichen und politischen Gesamtkontext stellt. In diesem Buch findet jeder etwas, der sich auch nur im Ansatz für das Thema Energie und Klima interessiert. Die ersten und letzten Kapitel würde ich sogar als Pflichtlektüre an Schulen vorschlagen, damit wenigstens die junge Generation in der Lage ist, auf allgemeiner Faktenbasis zum Thema Zukunft unseres Planeten zu diskutieren, ohne sich mit Teilinformationen aus halbgaren Quellen zu einseitigen Diskussionspartnern zu machen.
Gute Einsteigerliteratur nicht nur für Brennstoffzelleninteressierte
Enno Wagner liefert in seinem Buch „Das System Brennstoffzelle - Wasserstoffanwendungen ganzheitlich entwickeln“ einen grundlegenden und reflektierten Einblick in diesen Technologiebereich. Für das Verständnis ist dabei kein Ingenieursstudium notwendig, so dass auch technologisch interessierte Laien wertvolle Informationen und Hintergründe durch die klare Strukturierung und die leicht verständliche Sprache erhalten. Zentrale Aussagen sind hervorgehoben und der Text wird immer wieder durch Nebenbemerkungen aufgelockert.
Inhaltlich geht das Buch weit über die Brennstoffzelle hinaus – der Titel lässt dies bereits vermuten. Neben einem umfassenden, historisch interessanten Einblick in die Wissenschaftsgeschichte werden Entwicklungen, Meilensteine, aber auch notwendige naturwissenschaftliche Grundlagen von den Anfängen bis zur Jetztzeit, auch an konkreten Beispielen, erläutert. Ebenfalls werden aktuelle Forschungsaktivitäten und Ziele für zukünftige Entwicklungen aufgezeigt.
Ein Fokus liegt dabei auf der Bereitstellung (Ressourcen), Herstellung und dem Bedarf an Energie sowie Wasserstoff als Energieträger. Der Einflussfaktor „Mensch“ wird dabei auf unterschiedlichsten Ebenen betrachtet, auch mit Blick auf die Auswirkungen der Energienutzung aus Industrialisierung und steigendem Konsum vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Notwendigkeit der Energiewende.
Leider sind die Exkurse, z.B. in die Peripherie der Anlagentechnik, manchmal zu detailliert, und die eigentliche Brennstoffzellentechnologie (lediglich ein Kapitel von 10) kommt im Vergleich zu kurz. Bei der Technologiebeschreibung der PEM-Brennstoffzellen werden daher z.B. lediglich metallische Bipolarhalbplatten, und diese nur kurz, beschrieben, wobei es auch hier bereits Alternativen aus dem Compoundbereich gibt. Der kritische Vergleich und Ausführungen zur Assemblierung und Dichttechnologie wären, nicht nur für den Fachmann, interessant gewesen.
Insgesamt bietet dieses Buch aber einen umfassenden Überblick über eine zukunftsweisende Technologie und eine wertvolle Einstiegsliteratur.
Brennstoffzelle oder Elektrolyse reicht von der Chemie zu Mechatronik bis zu Wirtschaft und Politik
Das Buch „Das System Brennstoffzelle“ schafft einen gelungenen Spagat von der Theorie der Brennstoffzelle / Elektrolyse und damit verbundener Komplexität über erforderliche interagierende wirtschaftliche-technische Disziplinen dem Leser näher zu bringen. Er wird in eine ganzheitliche Sicht eingeführt und lernt zu verstehen, dass es diese Technik schon lange gibt und die Zukunft diese benötigt und welche Herausforderungen es zu lösen gibt.
Der Sachverhalt ist nachvollziehbar, flüssig zu lesen und vermittelt einen hervorragenden Überblick in die Themenwelt der Brennstoffzelle.
Enno Wagner liefert mit seinem gut lesbaren Buch einen Überblick über die ganze Komplezität der Wasserstofftechnik
Das Buch bietet einen sehr guter Überblick über die aktuelle Technik rund um Elektriseure und Brennstoffzellen. Hervorzuheben ist die klare Sprache und das hervorragende Layout. Schriftbild, Formelsatz, Abbildungen, Grafiken, etc tragen dazu bei, dass man gerne reinschmökert. Enno Wagner bemüht sich sehr auch schwierige Kapitel wie die thermodynamischen Hintergründe gut verständlich zu gestalten. Die Ausführungen zur benötigten Infrastruktur, zu regenerativen Energiesystem und auch zu wirtschaftlichen Aspekten runden das Buch ab.
Mein Kritikpunkt, zeigt sich Beispielhaft an der für mch zu kurzen Abhandlung der PEM-Brennstoffzelle. Die Gasverteilerplatten werden auf einer Seite abgehandelt. Andere Komponenten rund um den Brennstoffzellen-Stack wie aktive oder passive Rezierkulation auf der Anodenseite werden nicht ausgeführt. Das Buch darf also nicht als Anleitung wie baue ich mir eine Brennstoffzelle oder einen Elektrolyseur verstanden werden.
Das Buch ist eine kompetente Zusammenfassung für alle die sich mit dem "System Brennsoffzelle" beschäftigen möchten.
„Das System Brennstoffzelle“ bietet eine zugängliche Einführung in die Welt der Brennstoffzellen und erneuerbaren Energien und beleuchtet gleichzeitig die geschichtliche Entwicklung unserer Energieversorgung.
Das Buch „Das System Brennstoffzelle“ bietet eine leicht verständliche Einführung in die Brennstoffzellentechnologie und ist angenehm zu lesen. Besonders positiv hervorzuheben sind die ausführlichen Literaturverzeichnisse am Ende jedes Kapitels, die weiterführende Informationen für interessierte Leser bereithalten. Allerdings kommt in meinen Augen der technische Aspekt der Brennstoffzelle etwas zu kurz, da andere Energieträger und Energievisionen stattdessen ausführlich und detailliert behandelt werden. Die historische Darstellung der Energieversorgung der Menschheit ist dabei besonders interessant und informativ. Insgesamt ist das Buch eine solide Wahl für Leser, die sich einen ersten Überblick über Brennstoffzellen und erneuerbare Energien verschaffen möchten.
Seit 2019 lehrt und arbeitet Prof. Dr.-Ing. Enno Wagner im Bereich Mechatronische Konstruktion an der Frankfurt University of Applied Sciences, wo er ein Wasserstofflabor betreibt und mit seinen Mitarbeiter:innen an hocheffizienten Elektrolyse- und Brennstoffzellen forscht. Zuvor befasste er sich als Leiter verschiedener Entwicklungsabteilungen mit der Konstruktion von thermodynamischen Geräten und Anlagen für erneuerbare Energien. Prof. Wagner ist Inhaber mehrerer Patente und hat an zahlreichen Veröffentlichungen im internationalen Umfeld mitgewirkt.
Seit 2019 lehrt und arbeitet Prof. Dr.-Ing. Enno Wagner im Bereich Mechatronische Konstruktion an der Frankfurt University of Applied Sciences, wo er ein Wasserstofflabor betreibt und mit seinen Mitarbeiter:innen an hocheffizienten Elektrolyse- und Brennstoffzellen forscht. Zuvor befasste er sich als Leiter verschiedener Entwicklungsabteilungen mit der Konstruktion von thermodynamischen Geräten und Anlagen für erneuerbare Energien. Prof. Wagner ist Inhaber mehrerer Patente und hat an zahlreichen Veröffentlichungen im internationalen Umfeld mitgewirkt.
"Dieses Buch stellt das System Brennstoffzelle in ganzheitlicher Weise vor. [...] Das Buch wendet sich an Studierende der Mechatronik sowie der Verfahrens- und Energietechnik, ist jedoch gleichermaßen für Praktikerinnen und Praktiker geeignet, die mit der Entwicklung der Wassserstofftechnik betraut sind." VDI energie + umwelt, Mai 2024
"Dieses Buch stellt das System Brennstoffzelle in ganzheitlicher Weise vor. [...] Das Buch wendet sich an Studierende der Mechatronik sowie der Verfahrens- und Energietechnik, ist jedoch gleichermaßen für Praktikerinnen und Praktiker geeignet, die mit der Entwicklung der Wassserstofftechnik betraut sind." VDI energie + umwelt, Mai 2024
Die Coverdateien dürfen Sie zur Bewerbung des Buches honorarfrei verwenden.
Die Coverdateien dürfen Sie zur Bewerbung des Buches honorarfrei verwenden.
Carl Hanser Verlag GmbH & Co KG
Vilshofener Str. 10
81679 München
E-Mail: info@hanser.de
Sicherheitshinweis entsprechend Art.9 Abs. 7 Satz 2 GPSR entbehrlich
Carl Hanser Verlag GmbH & Co KG
Vilshofener Str. 10
81679 München
E-Mail: info@hanser.de
Sicherheitshinweis entsprechend Art.9 Abs. 7 Satz 2 GPSR entbehrlich